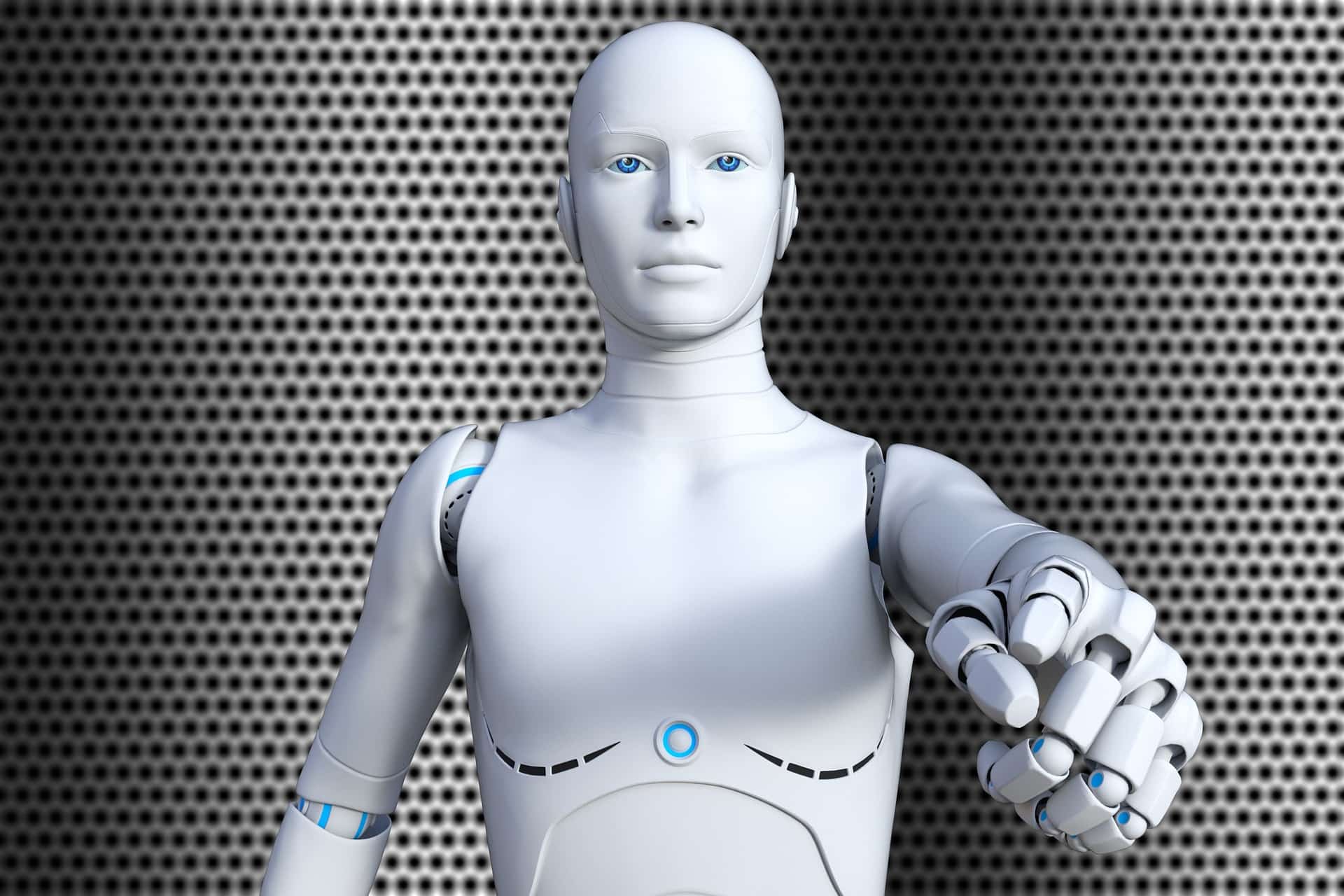Die Reaktionen der Unternehmen auf den Krieg in der Ukraine sind so unterschiedlich wie die Unternehmenslandschaft. Durch die Bank wurde der russische Angriff zwar verurteilt und auch mit Hilfsangeboten waren zahlreiche Unternehmen schnell zur Stelle. Doch bei der Frage, ob man sich aus Russland zurückziehen soll, entwickelte sich ein vielstimmigeres Bild. Am schnellsten wurden noch Handelsbeziehungen mit Russland und Investitionsvorhaben in Russland gestoppt. So haben praktisch alle namhaften Automobilhersteller ihre Geschäfte für beendet erklärt oder zumindest vorübergehend auf Eis gelegt. Ganz ähnlich sieht es in den meisten anderen Branchen aus, ganz gleich, wie stark diese von den staatlichen Sanktionen betroffen sind. Inzwischen sollen mehr als 600 westliche Unternehmen ihre Beziehungen zu Russland gekappt haben, vollständig oder vorübergehend.
Umsatzeinbußen und Reputationsrisiken
Das wird sich auch in den Bilanzen bemerkbar machen. So rechnet beispielsweise der Sportartikelhersteller Adidas mit einem Umsatzverlust von rund 250 Millionen Euro. Das Unternehmen aus Herzogenaurach hat seine Läden in Russland geschlossen, den Onlinehandel ausgesetzt und auch den Partnerschaftsvertrag mit dem russischen Fußballverband ausgesetzt. „Als Unternehmen verurteilen wir jede Form von Gewalt und zeigen uns solidarisch mit allen, die zum Frieden aufrufen“, sagte Vorstandschef Kasper Rorsted bei der Vorstellung der Bilanz 2021. Setzt man die 250 Millionen Euro ins Verhältnis zum Jahresumsatz 2021 (21,2 Milliarden Euro), so wirkt der Verlust verkraftbar. Tatsächlich rechnet Rorsted auch nicht mit Auswirkungen auf den prognostizierten Gewinn für 2022.
Größere Auswirkungen könnten Reputationsschäden haben, wenn Unternehmen in dieser Phase ihre Glaubwürdigkeit verspielen. Dieses Risiko wollte die Züricher Versicherung gar nicht erst eingehen. Sie hatten einfach Pech mit ihrem Logo. Gegenüber der Nachrichtenagentur DPA bestätigte das Schweizer Unternehmen, vorübergehend auf den isolierten Buchstaben Z im Außenauftritt, speziell in den Social-Media-Kanälen zu verzichten, weil dieser missverstanden werden könnte. Tatsächlich hat sich das Z eigentlich nur ein Markierungszeichen auf den russischen Militärfahrzeugen zum Symbol dieses Kriegs entwickelt. Inzwischen wurde die alleinstehende Verwendung schon in den unterschiedlichsten Formen verboten, selbst bei einigen Zulassungsstellen werden keine Autokennzeichen mit einem einzelnen Z mehr ausgegeben. Die Brisanz hat man in Zürich erkannt und schnell gehandelt.
Öffentlicher Druck zwingt Unternehmen zur Haltung
Weitaus schwieriger stellt sich der Umgang mit der Haltung für Unternehmen dar, die sich nicht vollständig aus dem russischen Markt zurückziehen wollen. Das reicht von Restaktivitäten wie bei Siemens, die ihre Service- und Wartungsverträge auch weiterhin bedienen wollen, bis hin zu Unternehmen, die eigene Werke oder Handelsniederlassungen unterhalten und für ihre Beschäftigten weiterhin Verantwortung übernehmen wollen. Betroffen sind sowohl Mittelständler beispielsweise aus dem Maschinenbau, aber auch multinationale Konzerne wie Nestle. Der Lebensmittelkonzern ist sowohl in Russland als auch in der Ukraine aktiv und betreibt eigene Produktionsstandorte. Für diese wurde in der Ukraine kurz nach Kriegsbeginn ein Produktionsstopp verhängt, um die eigenen Mitarbeiter zu schützen. Rund 5.800 Ukrainer und Ukrainerinnen sind bei Nestle beschäftigt. Ein Teil von denen hat das Land inzwischen verlassen und nach neuesten Meldungen sollen auch Kündigungen der Belegschaft zunehmen. Vor allem, weil Nestle seine Geschäfte in Russland weiter betreibt. Zwar hatte das Unternehmen in Russland seine Werbemaßnahmen eingestellt und Investitionsvorhaben ausgesetzt, vielen Verbrauchern, NGOS und auch einzelnen Politikern war dies nicht genug. Nach zunehmend heftiger werdender Kritik will sich Nestle zukünftig nur noch auf Grundnahrungsmittel beschränken und alle anderen Produkte nicht mehr nach Russland liefern.
Die Wucht öffentlicher Empörung traf auch den mittelständischen Schokoladenhersteller Ritter Sport. Russland ist nach Deutschland der zweitwichtigste Absatzmarkt des Unternehmens. Der Verzicht könnte also zu deutlichen Umsatzeinbußen führen und hätte damit auch weitreichende Folgen für den hiesigen Firmenstandort. In einem offenen Brief erklärte sich das Unternehmen, blieb aber bei seiner Haltung. „Uns ist Verantwortungsbewusstsein wichtiger als Gewinn“, hieß es darin. Ritter Sport wolle weiterhin seine Verantwortung für die Mitarbeiter tragen und machte zudem auf die weiteren Auswirkungen in der Lieferkette aufmerksam. Am Ende würde sich der Umsatzeinbruch auch bei den Familien der Kakaobauern bemerkbar machen. Auf Werbung und weitere Investitionen verzichtet Ritter Sport aber dennoch und will die Gewinne aus dem Russland-Geschäft an Hilfsorganisationen spenden.
Kriegsverlauf verändert die erste Einschätzung
Mit ähnlichen Argumenten haben zahlreiche weitere Unternehmen ihren Verbleib in Russland begründet, beispielhaft seien hier der Baumaschinenhersteller Liebherr oder der Industriekonzern GEA genannt. Mit dem weiteren Verlauf des Krieges ändern sich allerdings auch die Einschätzungen in den Vorstandsetagen. So hat SAP weitere Schritte angekündigt, seine Geschäfte in Russland nun vollständig zu beenden, nachdem bislang Wartungsverträge noch weitergeführt wurden. Auch Henkel vollzieht nun den letzten Schritt und wird sich vollständig aus seinem Russlandgeschäft zurückziehen. In ersten Schritten waren bereits Investitionsvorhaben und Werbemaßnahmen gestoppt worden. Rund 2.500 Mitarbeiter beschäftigt der Konsumgüterhersteller aus Düsseldorf in Russland und sieht sich auch für diese in der Verantwortung. Aber der fortschreitende Krieg mit seinen unzähligen Kriegsverbrechen hat in Düsseldorf zu einem Umdenken geführt. „Vor dem Hintergrund der aktuellen Entwicklungen haben wir entschieden, die Geschäfte in Russland aufzugeben“, teilt das Unternehmen mit. Man wolle sich nun in einem geordneten Prozess aus dem Land zurückziehen. Die Mitarbeiter vor Ort wären dabei eng eingebunden und würden auch weiter bezahlt.
Anders hat sich der Reifenhersteller Continental entschieden. Nachdem die Produktion zunächst eingestellt wurde, unter anderem aufgrund unterbrochener Lieferketten, hat man sie nun wieder aufgenommen und will dort zeitweise wieder produzieren. Gewinne wolle man damit aber nicht erzielen, ein Hinweis, den nahezu alle Unternehmen geben. Das Problem seien aber Konsequenzen für die leitenden Mitarbeiter vor Ort. Und auch die möglicherweise drohende Enteignung hält manche Unternehmen von einem Rückzug ab. Damit hat auch die Baumarktkette Obi gerechnet und ihre 27 Filialen in Russland zunächst geschlossen und inzwischen komplett an einen russischen Investor übertragen. Vorbehaltlich der behördlichen Genehmigungen ist das Kapitel Russland damit für Obi beendet. Bedingung für die Übertragung, für die kein Geld geflossen sein soll, ist, dass der Name zukünftig in Russland nicht mehr verwendet wird. Unternehmen wie Bayer oder die Metro verbleiben in Russland, weil sie es für ethisch vertretbar halten, etwa weil sie zur Grundversorgung der Bevölkerung beitragen.
Starke, schwache oder keine Reaktionen von Unternehmen
Kommerziell gebe es für Unternehmen in der derzeitigen Situation nichts zu gewinnen, aber viel zu verlieren, sagt Dr. Niklas Schaffmeister, geschäftsführender Gesellschafter der Managementberatung Globeone. „Marken sind wie Menschen auf der Grundlage von Werten positioniert. Sind diese Werte stark, kann man nicht einfach schweigen und weitermachen, wenn so etwas passiert wie aktuell in der Ukraine“, so Schaffmeister. Grundsätzlich sind nach seiner Einschätzung derzeit drei Reaktionsweisen von westlichen Unternehmen zu beobachten: Zum einen sehr starke Reaktionen, oft verbunden mit der langfristigen Aufgabe des Geschäfts. Zum anderen eher verhaltene Reaktionen, bei der es vor allem um ein vorläufiges Aussetzen von Aktivitäten gehe. „Diese Reaktionen erfolgen häufig unter dem Hinweis, die Situation weiter beobachten zu wollen oder begleitet von Spendenaktionen. Eine schnelle Rückkehr in den russischen Markt ist hier nicht ausgeschlossen“, so Schaffmeister. Und schließlich gebe es auch viele Unternehmen, die gar nicht oder allenfalls nur mit vagen Statements als Antwort auf den Druck der Öffentlichkeit reagierten. „Diese Reaktionsweise kann langfristig zu starker Kritik und zu Imageschäden führen, vor allem bei Unternehmen, die stark in der Öffentlichkeit exponiert sind“, meint Schaffmeister.
Hall of Shame listet Unternehmen auf
Einen genauen Überblick über das Verhalten von Unternehmen liefert die Auflistung von Jeffrey Sonnenfeld, Wirtschaftsprofessor an der US-Universität Yale. Mehr als 1.000 Unternehmen führt seine Liste inzwischen auf, die hierzulande auch als Hall of Shame bezeichnet wird. Die Liste wird ständig aktualisiert und verfeinert. Anfangs gab es nur die Unterscheidung zwischen „Raus“ oder „Bleiben“, inzwischen werden die Unternehmen einer von fünf Kategorien zugeordnet, von A für Unternehmen die sich komplett aus Russland zurückziehen bis zu F für Unternehmen die unbeirrt weitermachen. „Eine solche Liste erzeugt extremen Druck mit großer Wirkung. Sie ist ein Ranking von moralisch falschem Verhalten“, sagt Martin Kornberger, Professor für Wirtschaftsethik an der Wirtschaftsuniversität Wien, gegenüber der österreichischen Wirtschaftszeitung Der Standard. „Der Imageschaden für Unternehmen, die noch in Russland seien, sei jetzt schon enorm groß.“
Das könnte sich zukünftig auch bei den Kaufentscheidungen der Konsumenten bemerkbar machen. Nach einer Umfrage des Branchenverbands Bitkom würden deutsche Verbraucherinnen und Verbraucher genau hinsehen, wie sich Unternehmen derzeit positionieren. Immerhin 77 Prozent wollen in Zukunft davon ihre Kaufentscheidung abhängig machen. „Wer sich nicht klar an die Seite der Ukraine stellt, läuft Gefahr, das Vertrauen deutscher Kundinnen und Kunden zu verspielen und riskiert Einbußen“, sagt Bitkom-Präsident Achim Berg.
Konsumenten verlangen Rückzug aus Russland
Diese Ergebnisse zeigen sich auch in einer Studie der Agentur WeberShandwick, die in sechs Ländern durchgeführt wurde. Mit Deutschland, USA, Großbritannien, Japan, Kanada und Frankreich sind zwar nur Länder des westlichen Wertesystems vertreten, die sind sich in den grundlegenden Punkten aber einig. So ist der Krieg in der Ukraine in allen genannten Ländern mit Ausnahme der USA das derzeit wichtigste Thema. Ein großer Teil aller Befragten (72 %) erwartet von Unternehmen eine klare Position, wenn die Demokratie gefährdet ist. Insgesamt werden vor dem Hintergrund des Krieges in der Ukraine hohe Erwartungen an Unternehmen gestellt. So sollten sie für viele Befragte eine gewichtige Rolle spielen, um diesen Krieg zu beenden. An dieser Stelle wird die Verantwortung zwar überwiegend bei internationalen Organisationen wie der Nato oder der UN und den nationalen Regierungen gesehen, aber in Deutschland wird der Wirtschaft eine bedeutende Rolle zugeschrieben.
Im internationalen Vergleich zeichnet sich bei dieser Frage eine Sonderrolle Deutschlands ab. So sollten die Befragten eine Rangfolge festlegen, wer die Führung zur Beendigung des Krieges übernehmen sollte. Deutschland sieht auf dem 2. und 3. Platz die Wirtschaft/Industrie und Finanzwirtschaft. Erst an vierter Stelle wird die Regierung genannt. In allen anderen Ländern der Untersuchung werden diese erst auf den Plätzen 3 und 4 genannt, nach der eigenen Regierung. Das zeigt die Schwierigkeit, in der sich Unternehmen befinden, wenn sie sich nicht klar positionieren.
Auch an den eigenen Arbeitgeber werden diese Erwartungen gestellt, von denen allerdings nur rund ein Drittel diese Erwartung auch erfüllt. Diese wiederum haben als häufigste Maßnahme den Krieg verurteilt und/oder an Hilfsorganisationen gespendet. Die Erwartungshaltung der Belegschaften sieht ganz ähnlich aus. So werden die Bereitstellung humanitärer Hilfe und die Versorgungssicherheit der Menschen in der Ukraine als wichtigste Punkte genannt. Offizielle Statements, die Verantwortung gegenüber Mitarbeitern in Russland und die Neubewertung des Russlandgeschäfts rangieren dahinter, werden aber dennoch von einer Mehrheit erwartet.
Sanktionen zeigen Wirkung
Was bedeutet nun verantwortliche Unternehmensführung in der aktuellen Situation? Von den ESG-Kriterien ist in diesem Fall besonders die Governance gefordert. Die Unternehmen sind zwischen Haltung und ihrer gesellschaftlichen Verantwortung hin- und hergerissen. „Unternehmen, die ihre russischen Betriebe einstellen, haben immer noch eine Sorgfaltspflicht gegenüber ihren Arbeitnehmern – und respektieren ihre Rechte, sagte Anita Ramasastry, Mitglied der UN-Arbeitsgruppe für Wirtschaft und Menschenrechte, dem Magazin Politico. Unternehmen würden diese Entscheidungen oft zu schnell treffen, ohne ausreichend über die Konsequenzen und die dadurch verursachten Schäden nachzudenken. Unternehmen die für einen Verbleib in Russland argumentieren, weil ihr Rückzug vor allem die unschuldige Bevölkerung treffen würde, werden zunehmend als nicht glaubwürdig betrachtet.
Neben diesen Aspekten steht immer auch noch die Frage im Raum, was kann der Rückzug aus dem russischen Markt für diesen Krieg bewirken? Dass diese Frage nicht leicht zu beantworten ist, liegt auf der Hand. Inzwischen machen sich die Sanktionen und der Rückzug von Unternehmen in Russland aber bemerkbar. Moskaus Bürgermeister Sergej Sobjanin rechnet mit dem Verlust von mehr als 200.000 Arbeitsplätzen. Und auch Russlands Notenbank-Chefin Elvira Nabiullina sieht zunehmende Auswirkungen auf die reale Wirtschaft, nachdem in den ersten Wochen vor allem der Finanzmarkt betroffen war. Jetzt fordert sie eine Neuaufstellung der russischen Wirtschaft, schließlich könne man nicht dauerhaft von den Finanzreserven leben.
Wirtschaftsethiker mit unterschiedlichen Positionen
Das könnte für einen Rückzug aus dem russischen Markt sprechen und dem gerne verwendete Argument der Wirkungslosigkeit von Sanktionen widersprechen. Für Jeffrey Sonnenfeld ist auch völlig klar, wie sich Unternehmen entscheiden sollten. Nach seiner Auffassung sollten Verbraucher und Verbraucherinnen die Unternehmen boykottieren, die ihre Geschäfte mit Russland nicht beenden. Doch trotz klarer Positionierung bleiben Fragen offen, schließlich gibt es auch in anderen Gegenden dieser Welt kriegerische Auseinandersetzung, Menschrechtsverletzungen und Unterdrückung. Antworten könnte die Wirtschaftsethik liefern, doch auch unter deren Vertretern herrscht keine Einigkeit. Für den St. Gallener Wirtschaftsethiker Prof. Thomas Beschorner ist die Sache klar. In der Zeit schrieb er zusammen mit Kollegen: „Unternehmen sind jetzt gefordert, ihre Bedeutung als gesellschaftspolitische Akteure in stärkerem Maße zu reflektieren und als Corporate Citizen auch handlungspraktisch einzulösen.“ Unternehmen dürften sich jetzt nicht wegducken, sondern seien zum Handeln verpflichtet, denn „wir haben es in diesem Krieg mit nicht irgendeiner zwielichtigen normativen Position zu tun, die offenlässt, was das richtige Handeln ist.“ Es sei für Unternehmen ethisch geboten, ihre Macht für ein Ende des Krieges einzusetzen. „Es geht nicht nur um ein erweitertes Kosten-Nutzen-Denken und um die Sorge der Reputation. Es ist die Verantwortung und die moralische Pflicht von Unternehmen, durch ihr Handeln friedensstiftend zu wirken“, so Beschorner und Kollegen.
Dem widerspricht der Wirtschaftsethiker Prof. Ingo Pies nicht grundsätzlich, mahnt aber zur Zurückhaltung. In einem Aufsatz für das Forum Wirtschaftsethik schreibt er: „Selbst wenn man extrem harte Wirtschaftssanktionen für geeignet hält, das ausgewiesene Ziel zu erreichen, folgt daraus keineswegs, dass man die für nötig gehaltene Eskalation der Wirtschaftssanktionen den Unternehmen als eine Aufgabe zuweist, die sie auf freiwilliger Basis zu erfüllen haben. Wer die Eskalierung von Boykott und Embargo für nötig hält, sollte sie per Gesetz vorschreiben. Alles andere ist nicht marktkonform und fordert die Unternehmen nicht, sondern überfordert sie.“ Auch der Wirtschaftsethiker des Instituts der Deutschen Wirtschaft Prof. Dominik Ernste, rät im Deutschlandfunk, Unternehmen sollten kühl abwägen und nicht zu vorschnelle moralische Entscheidungen treffen. Allerdings, so Ernste: „Unternehmen, die in keiner Weise auf den Krieg gegen die Ukraine reagiert haben, kann man aus wirtschaftsethischer Perspektive nur raten, zumindest sorgfältig zu prüfen, ob das nicht mit einem erheblichen Reputationsschaden am Ende einhergehen kann.“
Dieser Beitrag erschien zuerst auf csr-reporter.de.