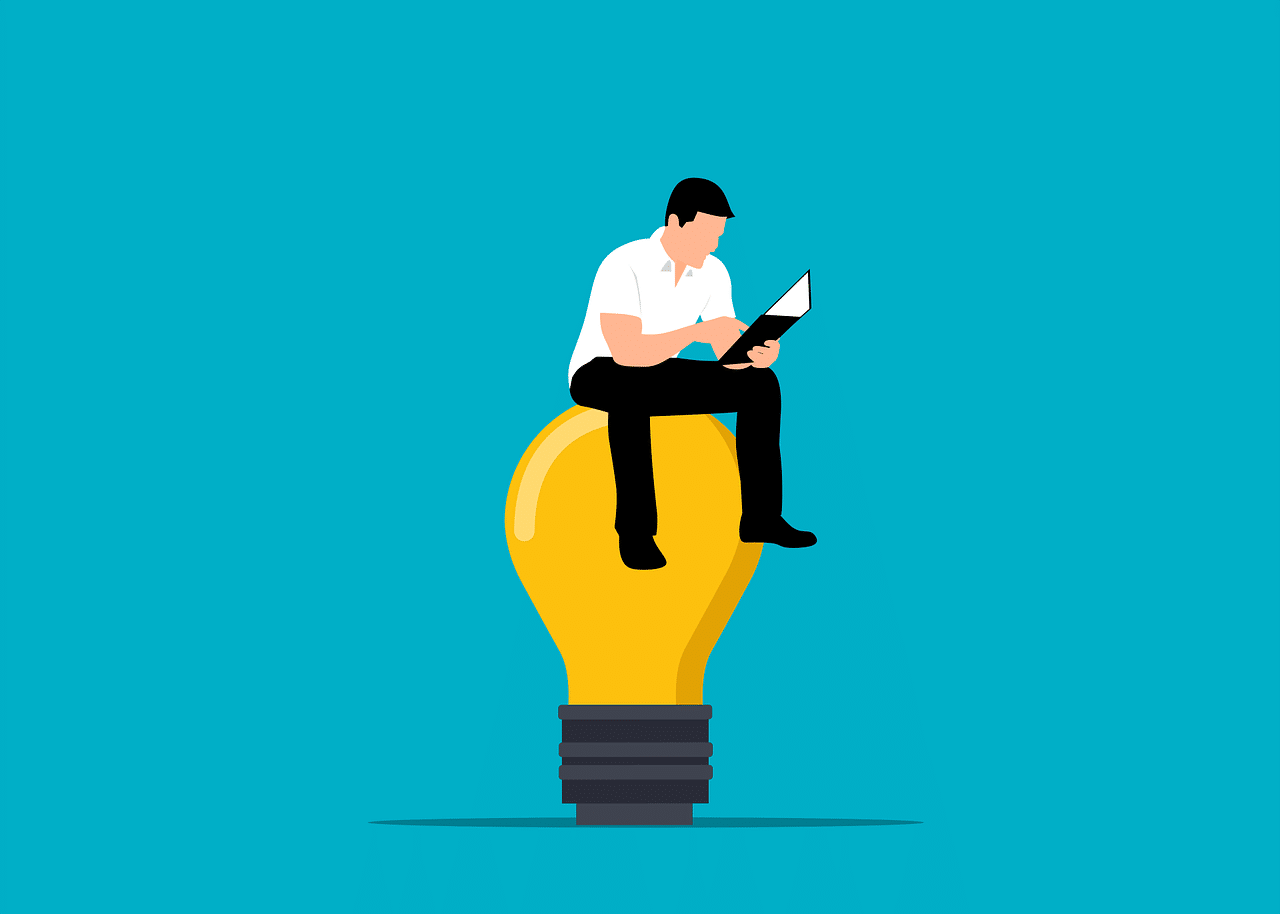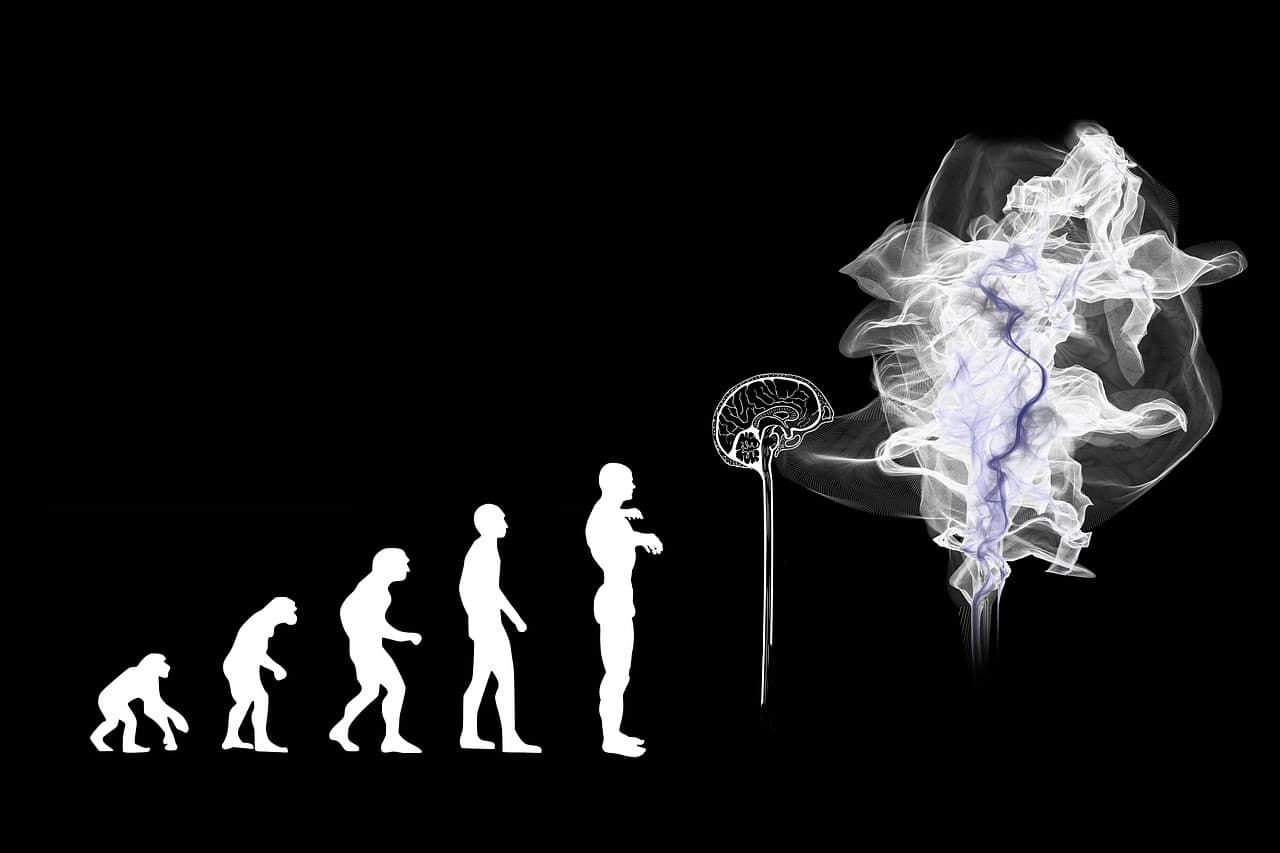Wann hat diese Krise begonnen und wann wird sie beendet sein? Je nach Betrachtungsweise gibt es dafür unterschiedliche Antworten. Wirtschaftskrisen entstehen nicht von heute auf morgen, meist deuten sie sich an, gibt es Anzeichen für einen bevorstehenden Abschwung. Auch die aktuelle Krise machte früh auf sich aufmerksam, nur erkannt wurde sie nicht immer. Oder die Mahner wurden als unverbesserliche Pessimisten abgetan und nicht gehört, wenn auch die tatsächlichen Ausmaße in dieser Ausprägung selbst von Fachleuten und Insidern nicht vorhergesehen wurden. Dies galt bereits in ähnlicher Weise, als die New-Economy-Blase am Anfang dieses Jahrzehnts platzte.
Während in den USA die ersten Hypothekenbanken ins Trudeln gerieten, wurde bei uns von anhaltendem Aufschwung geredet, wurde der nahe Ausgleich der Staatsverschuldung proklamiert, war die amerikanische Subprime-Krise weit weg und maximal ein Problem der amerikanischen Regierung. Dann kam der 15.09.2008, ein Tag, der sich seinen Platz in der internationalen Wirtschaftsgeschichte gesichert hat. Die amerikanische Investmentbank Lehman Brothers verkündete ihre Insolvenz. Ab diesem Moment war sie da, für jeden sichtbar, die globale Finanzkrise, ab diesem Moment verstummten auch die letzten Optimisten.
Die Stunde der Wirtschaftsjournalisten
Jetzt überschlugen sich die Meldungen, war schnelles und wirksames Handeln gefragt. Jetzt schlug auch die Stunde der Wirtschaftsjournalisten. Manche noch zögerlich: der ARD beispielsweise war dieses Thema keinen „Brennpunkt“ im Anschluss an die „Tagesschau“ wert, wie er sonst bei mittleren und großen Katastrophen gesendet wird. Trotzdem wurden in den Redaktionen der großen Zeitungen Teams zusammengestellt, die sich ausschließlich mit der Krise beschäftigten; die Wirtschaftsredaktionen mussten Titelseiten füllen, Dossiers erstellen und kommentieren. Das sollte auch erst mal so bleiben. Mit der Hypo Real Estate geriet ein Schwergewicht der deutschen Bankenlandschaft in Schieflage und musste mit Milliarden von Steuergeldern gerettet werden, bevor sie schließlich verstaatlicht wurde. Wirtschaftsthemen, wie sie vorher nicht vorstellbar waren. Es dauerte nur wenige Monate, dann folgte den Banken die „reale“ Wirtschaft, wurde aus der Finanzkrise eine Weltwirtschaftskrise.
Schnell wurde nach den Verantwortlichen gesucht. In einem ersten Reflex standen Banker und Topmanager am Pranger, gefolgt von der „menschlichen Gier“ und dem „Kapitalismus“ an sich. Der Frage nach den Schuldigen folgte die Frage nach der Vorhersehbarkeit: Warum haben Aufsicht, Ratingagenturen und Wirtschaftsforscher diese Krise nicht frühzeitig erkannt und vor ihr gewarnt? Diese Frage wurde schnell auch an die Wirtschaftsjournalisten gestellt.
Hat der Wirtschaftsjournalismus versagt?
Anlässlich der Verleihung des „Otto-Brenner-Preis 2008“ gab der ehemalige Intendant des WDR, Fritz Pleitgen, eine klare Antwort: „Es ist ein kapitales Versagen unseres Berufsstandes, Entwicklungen wie die gegenwärtige Finanzkrise nicht aufgespürt zu haben.“ Von Versagen spricht auch Wolfgang Kaden. Der ehemalige Chefredakteur des „Manager Magazin“ sagte in einem Interview mit dem „Wirtschaftsjournalist“: „Es haben viele versagt. Banker, Politiker, vor allem die amerikanischen Aufseher, Wirtschaftsprüfer und die Journalisten eben auch.“ Allerdings schränkt Kaden das Versagen des Wirtschaftsjournalismus ein: „Er hat im Vorfeld versagt und später, als die Krise evident war, exzellente Arbeit geleistet.“ „Schließlich“, so Kaden weiter, „handelt es sich um komplizierte Sachverhalte, in die auch Finanzjournalisten sich einarbeiten müssen. Das Ergebnis war leserfreundlich, aktuell, Aufklärungsarbeit im besten Sinn. Viele Redakteure haben bis an den Rand der Erschöpfung gearbeitet.“ Diesem Urteil schließt sich Altkanzler Helmut Schmidt an. Auf der diesjährigen Tagung des Berufsstands, dem „Tag des Wirtschaftsjournalismus“ in Köln, attestierte er eine ordentliche Berichterstattung, hielt allerdings die Kommentierung für zu vorsichtig. Sein Fazit: „Der deutsche Wirtschaftsjournalismus macht es dem Leser nicht leicht, sich ein eigenes Urteil zu bilden.“
Natürlich gibt es nicht „den“ Wirtschaftsjournalismus und entsprechend nicht „den“ Wirtschaftsjournalisten. Während einzelne, insbesondere Fachmedien, frühzeitig die möglichen Auswirkungen des amerikanischen Immobilien-Booms erkannten und auch publizierten, kam die auftauchende Krise in den Publikumsmedien eher nicht vor und ging damit an weiten Teilen der Bevölkerung vorbei. In manchen Redaktionen, vor allem in den Fernsehanstalten, scheut man sich nicht, die fehlende Expertise zuzugeben. Die Analyse der Krise kam dadurch oft zu kurz, im Vordergrund standen Ratgeberbeiträge und natürlich die aktuellen Nachrichten.
Dramatische Formulierungen führten zu größerer Verunsicherung
Die teilweise dramatischen Entwicklungen an den Finanzmärkten und die einsetzende Berichterstattung mit ebenso dramatischen Formulierungen führten dann auch eher zu größerer Verunsicherung als zu weiterer Aufklärung. Wochenlang bestimmten Bankenpleiten, gigantische Rettungsmaßnahmen, Börsenturbulenzen und die „wahrscheinlich schlimmste Wirtschaftskrise seit den Zwanzigerjahren des letzten Jahrhunderts“ die Nachrichten. Dieser Umstand ist allerdings sicherlich nicht allein dem Journalismus anzulasten. Politiker, Forschungsinstitute und Experten überboten sich in ihren düsteren Vorhersagen frei nach dem Motto „only bad news are good news“. Die folgerichtige Reaktion der Verbraucher, „Ist mein Geld noch sicher?“, bestimmte demzufolge auch die weitere Berichterstattung. Den Medien wurde von vielen Seiten „Zurückhaltung“ attestiert, die Bankkunden sollten schließlich ihr Vertrauen nicht verlieren. Die Sorge war groß durch eine zu drastische Berichterstattung die Sparer mit der festen Absicht, ihre Ersparnisse zukünftig lieber unter dem Kopfkissen zu horten, an den Bankschalter zu treiben. Eine Gratwanderung; schließlich sollte die aktuelle Entwicklung auch nicht beschönigt werden. „Dabei wäre es an bestimmten Tagen der richtige Rat gewesen: Nimm dein Geld mit nach Hause“, zeigt Roland Tichy, Chefredakteur der „Wirtschaftswoche“, das Dilemma auf: „Es ist ein Paradoxon, dass die korrekte Berichterstattung genau das ausgelöst hätte, vor dem zu warnen ihre Aufgabe ist“. Zur Entspannung trugen letztlich eher Bundeskanzlerin Angela Merkel und ihr Finanzminister Peer Steinbrück bei, als sie vor laufenden Kameras die Sicherheit der Spareinlagen durch den Staat garantierten. Bei welcher Sparanlage die Konsumenten auch in Zukunft ruhig schlafen können und bei welchen Sparformen Vorsicht angebracht ist, war sicherlich für viele Leser eine neue Auseinandersetzung mit ihrem Geld. Erstmalig wurden Begriffe wie Einlagensicherung oder Emittentenrisiko für viele verständlich, aber auch kritisch erläutert. Der Trend zum Nutzwertjournalismus und zur Personalisierung hielt somit in der Krise weiter an. Es wurden nicht nur Ratgeberseiten mit Tipps für „den richtigen Weg durch die Krise“ gefüllt, sondern auch reihenweise Geschichten von Geschädigten, beispielsweise der Lehman-Pleite oder der isländischen Kaupthing-Bank, publiziert. Daran lässt sich auch das umfangreiche Spektrum des Wirtschaftsjournalismus aufzeigen: Neben den Spezialisten in den Wirtschaftsmedien, Fachpublikationen und den überregionalen Tageszeitungen wirken die Allrounder in den Publikumsmedien sowie in immer größerer Zahl die sogenannten Nutzwertjournalisten mit ihrem verbraucherorientierten Ansatz. Wirtschaftsjournalismus findet also im Spannungsfeld zwischen Wächterfunktion und Dienstleistung, zwischen volks- und betriebswirtschaftlicher Analyse und ratgeberorientierter Berichterstattung statt. Hinzu kommt die Spezies der Finanzjournalisten mit ihrer Expertise des internationalen Börsenhandels. Ansprüche, Arbeitsweise und Leserschaft der Wirtschaftsjournalisten sind demnach so unterschiedlich wie ihre Aufgabengebiete. Zusätzlich gibt es durch die Krise noch verstärkt viele Berührungspunkte mit anderen Ressorts, – insbesondere dem Politischen. Dies allerdings nicht immer ohne Spannung in den Redaktionen, wenn Wirtschaftsthemen verstärkt auf die Titelseiten drängen. Selbst beim „Spiegel“ gehören Wirtschaftsthemen auf dem Titel inzwischen eher zur Regel als zur Ausnahme, und das mit Erfolg. Die großen Titelthemen über die Krise räumen nicht nur Journalistenpreise ab, sondern sind außerdem am Kiosk erfolgreich.
Aufklärende Berichterstattung im Vorfeld?
Warum hat es diese erläuternde, aufklärende Berichterstattung nicht bereits im Vorfeld gegeben? Die Gründe mögen vielfältig sein, ein entscheidender Aspekt ist der Glaube an die Heilkräfte des wirtschaftlichen und politischen Systems. Ein Glaube, wie er in vielen Wirtschaftsredaktionen vorherrscht. Eine Zeit, in der sich eine Bank nach der anderen vom Markt verabschiedet, schien unvorstellbar.
Greg Ip, der US-Wirtschaftskorrespondent des „Economist“ sieht die ersten kritischen Berichte über den amerikanischen Immobilienmarkt bereits im Jahre 2003. Damals berichtete der „Economist“ in einer Titelgeschichte über die Entwicklung der Immobilienpreise in den USA. Die Namen der amerikanischen Immobilienfinanzierer Freddie Mac und Fannie Mae tauchten bereits auf. Die Preise stiegen weiter zusammen mit der Schwierigkeit, mit kritischen Aussagen durchzudringen. „Warnungen sind nicht beweisbare Vorhersagen“, so Greg Ip, „wenn sie zu oft kommen, aber nicht kurze Zeit später eintreten, dann werden sie nicht mehr gehört.“ 2007 nahmen die Probleme von Freddie Mac und Fannie Mae weiter zu und wurden langsam zum Thema in den deutschen Wirtschaftsmedien. Zwei bislang wenig bekannte Namen, die eher an bunte Kaufhausketten erinnern als an solide Finanzunternehmen. Mit der Schieflage der US-Investmentbank Bear Stearns verschärfte sich die amerikanische Krise. Die amerikanische Notenbank musste eingreifen, um das Überleben zu sichern. Ein erstes deutliches Anzeichen für die aufkeimende Krise, die ihren vorläufigen Höhepunkt dann durch die Pleite von Lehman Brothers erreichte. Bis zu diesem Tag wurde das Ausmaß einer möglichen globalen Finanzkrise unterschätzt, darin scheinen sich Wirtschaftsjournalisten einig zu sein. Bei Ursachen, Gründen und Schlussfolgerungen teilen sich dann wieder die Meinungen.
Für den „Economist“-Korrespondenten Greg Ip stellt sich bereits die Frage nach der nächsten Krise. „Derzeit wird viel und gut über die Krise berichtet“, so Ip, „ich mache mir aber Sorgen, ob wir die Reaktionen auf die Krise, die ausufernden Konjunkturprogramme ausreichend hinterfragen.“ Diese Gefahr sieht auch der Hamburger Medienprofessor Siegfried Weischenberg. In einem Interview mit der „Süddeutschen Zeitung“ sagt er: „Ich sehe das Problem, dass der deutsche Wirtschaftsjournalismus alles, was jetzt in der Krise an Ideen aus der Politik kommt, vorschnell absegnet. Nach dem Motto: Der Staat wird es schon richten.“
Die verbraucherorientierte Berichterstattung wird weiter zunehmen.
„Fakten, Fakten, Fakten – und immer an die Leser denken“, war der bekannte Slogan des Wochenmagazins „Focus“. Was aber erwartet der Leser? Orientierung, Aufklärung, Hintergründe sind Anforderungen, wie sie an alle Medien gestellt werden, selbstverständlich Rezipienten orientiert. Die Leser des „Handelsblatt“ erwarten andere Analysen als die Leser einer regionalen Tageszeitung. Die Masse der Bevölkerung wird aber über die Publikumsmedien erreicht. Gleichzeitig ist die wirtschaftliche Allgemeinbildung in der Bevölkerung nicht besonders ausgeprägt, wie zahlreiche Studien belegen. Wie gegenwärtig „systemrelevante“ Unternehmen mit riesigen Milliardenbeträgen gerettet und Banker zugleich mit Millionenbonifikationen belohnt werden, ist kaum noch zu vermitteln und führt zu Verärgerung und Verunsicherung. Orientierung finden für die eigenen finanziellen Entscheidungen wird in Zeiten, in denen Banken ums Überleben kämpfen und das ganze System der Finanzberatung am Pranger steht, für die meisten Konsumenten noch schwerer. Hilfe aus der Zeitung verspricht der Nutzwertjournalismus. Eine heikle Gratwanderung für Journalisten, von denen Rat erwartet wird, die aber kaum konkrete Ratschläge nennen dürfen. Auf dem diesjährigen „Tag des Wirtschaftsjournalismus“ haben einige Vertreter dieser Zunft darüber debattiert. Zurückhaltung war der Tenor. Selbst wenn die Redaktionen in der Vergangenheit konkrete Tipps gegeben haben, rücken die meisten inzwischen davon ab. Der Leiter der Programmdirektion Wirtschaft beim WDR-Hörfunk, Uwe Möller, beurteilte die vergangene Praxis der konkreten Anlageempfehlung als Fehler. Ebenso empfindet es Alexander Hagelüken, leitender Redakteur Finanzen bei der „Süddeutschen Zeitung“: „Derzeit ist es sehr schwierig, über Geldanlagen zu berichten. Allerdings war es nie der Geist der ,Süddeutschen‘ zu schreiben: Kaufen sie das“, so Hagelüken. Auch für den Leiter der Wirtschaftsredaktion beim Hessischen Rundfunk, Thomas Hütsch, gilt die redaktionelle Vorgabe, keine konkreten Anlageempfehlungen zu geben. Eine deutlich andere Auffassung von seiner Aufgabe als Verbraucherjournalist hat der Chefredakteur des Magazins „Finanztest“, Hermann-Josef Tenhagen. Er sieht den klaren Wunsch der Leser nach konkreter Hilfe und Orientierung. Diese will er mit „Finanztest“ auch bieten und den Lesern klar sagen, wo sie ihr Geld anlegen können und wo sie besser Abstand halten. „Mit einfachen ,Top‘- oder ,Flop‘-Kategorien ist dies allerdings nicht zu machen“, so Tenhagen, „dafür sind Anlageentscheidungen zu individuell.“ Für Tenhagen ist vor allem der Verbraucherjournalismus an sich gefährdet, wenn eine kritische Berichterstattung unterbleibt und Empfehlungen nicht mehr ausgesprochen werden. „Dann überlassen wir die Produktberichterstattung den PR-Leuten.“
Die verbraucherorientierte Berichterstattung wird weiter zunehmen. Dies ist eine der wahrscheinlichen Folgen der Krise für den Wirtschaftsjournalismus: Möglicherweise zurückhaltender bei den konkreten Empfehlungen, dafür mit mehr Hintergrund. Dem Leser eine Entscheidungsgrundlage bieten, ist der Tenor in zahlreichen Redaktionen, die konkrete Entscheidung möge er aber bitte selber treffen. So entzieht sich der Verbraucherjournalismus dem Dilemma falscher Vorhersagen. Entweder zu früh verkauft oder zu spät gekauft macht an den Börsen eben den Unterschied aus. Auf diesen Unterschied setzen die Anlegermagazine. Nahezu unbeirrt von der Krise titeln sie weiterhin mit ausufernden Renditeerwartungen, gerade so, als habe es eine Finanzkrise nie gegeben. Allerdings werden die Erwartungen in den Artikeln zurückgeschraubt, in den Redaktionsstuben der Anlegermagazine walten offensichtlich auch Vorsicht und Zurückhaltung.
Eine weitere Folge für den Wirtschaftsjournalismus: Die Wirtschaftskrise ist auch eine Medienkrise. Der drastische Rückgang der Anzeigen geht nicht spurlos an den Verlagen vorbei. Dabei sind die Wirtschaftsmagazine das am stärksten betroffene Segment. Banken, Versicherer und Fondsgesellschaften haben mit den ersten Anzeichen der Finanzkrise ihre Anzeigenaufträge storniert. Brancheninsider vermuten in der Folge auch eine weitere Marktbereinigung, insbesondere bei den Anlegermagazinen, denen inzwischen auch die Käufer abhandenkommen. Nach dem Zusammenbruch der New Economy ist bereits eine Vielzahl an Wirtschaftstiteln verschwunden, die allerdings erst durch den Börsenboom ins Leben gerufen wurden. Verluste von 30 bis 40 Prozent gegenüber dem Vorjahr sind bei den Anzeigenerlösen derzeit die Regel. Eine baldige Erholung ist nicht in Sicht. Damit verstärkt sich das Dilemma der ohnehin schon stark ausgedünnten Wirtschaftsredaktionen. Qualitätsjournalismus muss auch bezahlt werden können. Der wird oft nur noch in den Redaktionen der großen Magazine und Wirtschaftszeitungen geleistet. Mit annähernd stabilen Verkaufszahlen könnten sie als die Gewinner aus der Krise hervorgehen. Der Chefredakteur des „Wirtschaftsjournalist“, Markus Wiegand, sieht allerdings auch die Verbraucher in der Pflicht. „Wenn die Leute mehr Wirtschaftsthemen lesen würden, dann wären auch die Mittel vorhanden, um dem Anspruch des investigativen, aufklärenden Wirtschaftsjournalismus stärker gerecht zu werden“. Und: „Es ist ja nicht so, dass die Anzeichen der Krise verschwiegen wurden; sie standen nur nicht in den regionalen Tageszeitungen“.
Der Wirtschaftsjournalismus hat durch die Krise an Bedeutung gewonnen.
Die Zukunft des Wirtschaftsjournalismus ist nicht gefährdet, dessen sind sich die Vertreter dieses Berufs einig. Wirtschaft betrifft fast alle Bereiche des Lebens und jeder sieht sich mit wirtschaftlichen Fragestellungen konfrontiert. Der Wirtschaftsjournalismus hat sogar durch die Krise an Bedeutung gewonnen. Wirtschaft, insbesondere die Finanzwirtschaft, ist eine teils hoch komplexe Thematik. Diese zu durchschauen und zu übersetzen, verlangt nach Spezialisten. Im publizistischen Selbstverständnis des „Handelsblatt“ heißt es: „…Wirtschaftsmedien müssen Durchblick schaffen. … Der moderne Wirtschaftsjournalist taucht ,tief‘ in seine spezifische Fachmaterie ein … Aber er darf nicht nur Fakten aufbereiten. Er muss Themen mit den Augen des Lesers erkennen, Entwicklungen sortieren und analysieren.“ Ein Anspruch, wie er für alle Wirtschaftsredaktionen gelten sollte. „Tatsächlich haben wir eine zweigeteilte Gesellschaft“, so Christoph Moss, Professor für Unternehmenskommunikation und ehemaliger Redakteur des Handelsblatt. „Wir haben sehr gut ausgebildete Journalisten in der Spitze bei den Qualitätstiteln, die Bilanzen lesen können und ihre Arbeit beherrschen. Aber die Masse der Wirtschaftsberichterstattung findet bei Lokal- und Regionalzeitungen statt. Ausbildung in der Breite ist deshalb eine Antwort auf die Krise des Wirtschaftsjournalismus.“ Können Journalisten Entwicklungen vorwegnehmen, kann es einen antizipativen Wirtschaftsjournalismus geben? Roland Tichy, Chefredakteur der „Wirtschaftswoche“, hält das für sehr schwierig. „Wirtschaftsjournalisten müssen Anzeichen einer Krise deuten können, sie müssen erkennen, wenn sich Ungleichgewichte im Markt aufbauen; konkret Krisen benennen können sie nicht“.
„Die Wirtschaftswoche hat die Anzeichen der Krise bereits frühzeitig thematisiert. Dafür ist uns Schwarzmalerei vorgeworfen worden“, so Tichy, der dafür inzwischen zum „Wirtschaftsjournalist des Jahres 2008“ gekürt wurde. „Das führt den Wirtschaftsjournalismus in eine fragwürdige Situation“, so Tichy weiter, „denn wer dreimal ,Feuer‘ schreit, ohne dass die Hütte brennt, gilt beim vierten Alarm als berufsmäßiger Pessimist und wird nicht mehr gehört.“ „Aus heutiger Sicht ist die Entwicklung der Krise wunderbar zu analysieren“, meint auch Markus Wiegand, „aber wer will denn die Krisenszenarien lesen, wenn sie erscheinen?“ Auch Christoph Moss hält einen antizipativen Wirtschaftsjournalismus für nicht realisierbar: „Man kann von Wirtschaftsjournalisten auch nicht erwarten, dass sie mehr leisten als Analysten und Wirtschaftsforscher“.
Inzwischen gibt es erste Anzeichen einer leichten Erholung der Konjunktur. Und schon schallt es aus dem Blätterwald: Die Krise ist vorbei, wir haben es geschafft. Das gleiche Muster wie zu Beginn der Krise. Vielleicht schafft es der Journalismus auf diesem Weg, die Entwicklung zu intensivieren. Umgekehrt geschieht dies sehr schnell, eine Besonderheit des Wirtschaftsjournalismus: Die Berichterstattung kann Trends verstärken. Die vielleicht wichtigste Schlussfolgerung ist: Wirtschaft lässt sich nicht immer auf eine einfache Formel bringen. Wichtig sind deshalb die richtigen Fragen zur richtigen Zeit und an die richtigen Personen. Dann wird der Wirtschaftsjournalismus auch in breiter Form seine Leser finden und die Zweiteilung zwischen Qualitätsjournalismus auf der einen und Mainstream auf der anderen Seite weicht einem hintergründigen, aufklärenden und auch spannenden Wirtschaftsjournalismus. Denn eines ist sicher: Die nächste Krise kommt bestimmt.
Der Text erschien zuerst im Magazin Fachjournalist.