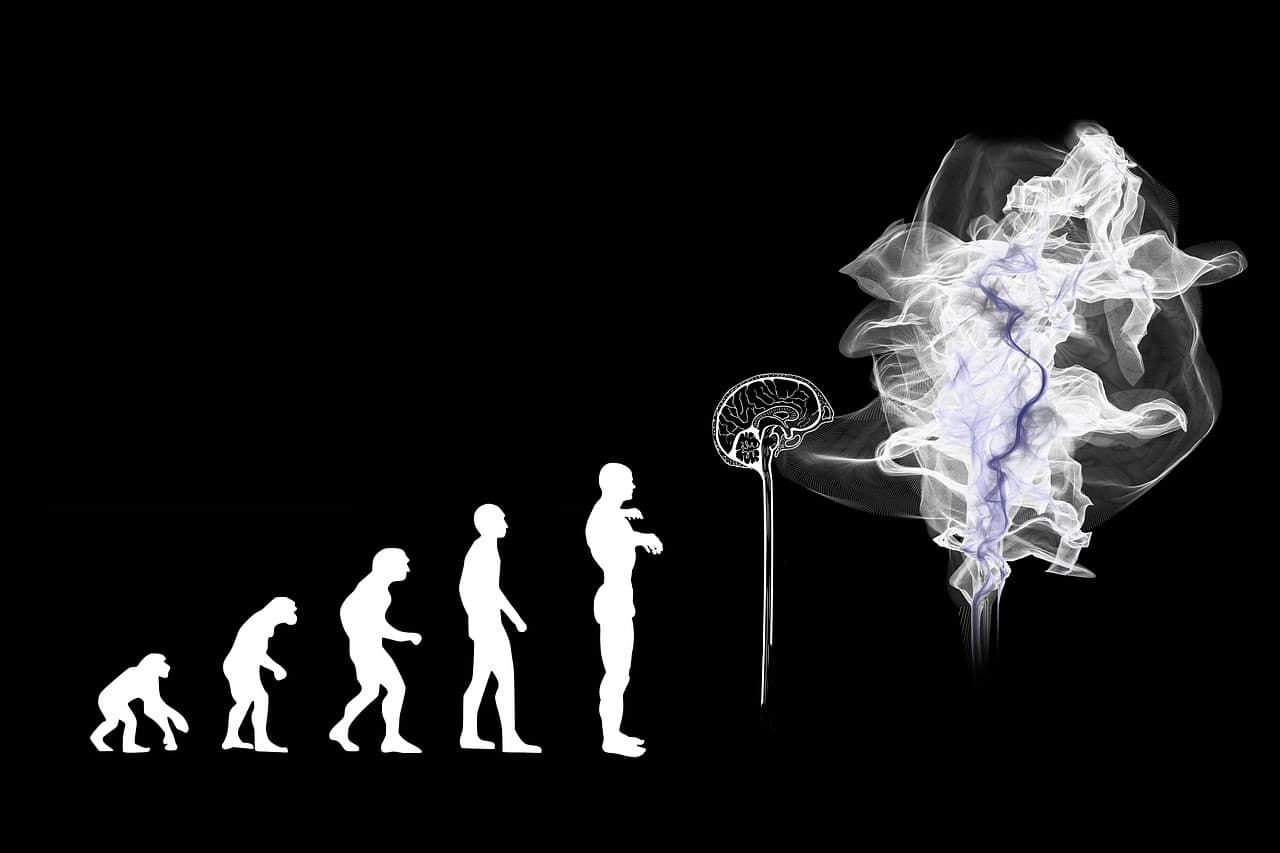Der fortschreitende Einzug digitalisierter Prozesse und Produkte in nahezu alle Branchen scheint disruptiv zu sein. Was gestern noch galt hat schon morgen keine Bedeutung mehr. Doch stimmt das eigentlich? Bei genauer Betrachtung wird die Mogelpackung entlarvt. Nicht überall wo digital draufsteht, ist Disruption drin.
Von der Pole-Position ins Aus
Disruption ist ein hässliches Wort. Zerstörung, oder vielleicht etwas milder Unterbrechung oder Veränderung, wirken erstmal unbequem, machen Schluss mit Gewohnheiten können gar Angst einflössen. Ganz anders die Digitalisierung. Damit verbinden wir im besten Sinne des Wortes Innovation, Fortschritt und insgesamt eher Verbesserung. Was ist dann digitale Disruption?
Als ein Beispiel wird dann gerne der Niedergang der Traditionsmarke Kodak genannt. Vom bedeutenden Produzenten fotografischer Ausrüstung auf direktem Weg in die Pleite. Möglich machte das der Siegeszug der Digitalkamera, denn selbst orthodoxe Anhänger der analogen Fotografie konnten die Vorteile der Digitalfotografie nicht dauerhaft ignorieren. Die zunehmende Verbreitung der Smartphones mit integrierter Digitalkamera besorgte den Rest. Alle Versuche des amerikanischen Unternehmens den Anschluss erneut zu bekommen scheiterten und endeten schließlich 2012 mit der Insolvenz und dem Verkauf der Fotosparte. Heute hat Kodak im Geschäft mit der Fotografie keine Bedeutung mehr. Das eigentlich tragische an diesem Beispiel ist, das Kodak die Digitalkamera erfunden hat, das Potenzial der Erfindung aber nicht wirklich erkannte.
Sicher ist Kodaks Entwicklung nicht nur auf eine frühe Fehlentscheidung zurückzuführen. Aber das Beispiel zeigt sehr anschaulich was der kürzlich verstorbene Clayton Christensen, Erfinder des Begriffs „disruptive Innovation“, immer wieder betonte. Clayton nannte dies erhaltende Innovation. Das meint nichts anderes, als dass sich erfolgreiche Unternehmen auf ihre lukrativen Kunden und Geschäftsfelder konzentrieren und für diese bestehende Produkte immer weiter verbessern. Riskanten neuen Entwicklungen geht man dann lieber aus dem Weg und scheitert am Ende. Ein Dilemma für etablierte Unternehmen, aber eine Chance für Start-ups.
Kulturwandel mit Tücken
Manager müssen disruptive Technologien frühzeitig erkennen können, um in ihren Geschäftsfeldern erfolgreich zu bleiben, war sich Clayton sicher. Doch dafür bräuchte es andere Organisationsstrukturen, in denen sich disruptive Innovationen entwickeln können. Inzwischen sind seine Worte in den Vorstandsetagen angekommen und immer mehr Großkonzerne versuchen bei Start-ups anzubändeln. Mit mäßigem Erfolg, denn disruptive Innovationen lassen sich nicht einfach in einer kurzen Auszeit mit Start-up-Kultur entwickeln und dann in schwerfällige Konzernstrukturen einbinden. Disruption braucht Querdenker und Regelbrecher, aber die werden in Konzernen nicht gerne gesehen. Disruption bedeutet aber immer auch Risiko und die Möglichkeit des Scheiterns. Das mögen Konzernlenker genauso wenig.
Clayton beschreibt in seinem Buch „The Innovators Dilemma“ zwei mögliche Prozesse disruptiver Innovationen. Beiden gemein ist der Anspruch, mit geringen Ressourcen und viel Lust an der Gestaltung etablierte Unternehmen und Geschäftsfelder herauszufordern. Junge Unternehmen mit disruptiven Geschäftsideen fang genau da an, wo etablierte Unternehmen nicht hinschauen. Sie wollen das einfachere Produkt, preiswerter und mit Potenzial zur Skalierung. Disruptive Unternehmen stellen den Kundenutzen und das Kundenbedürfnis in den Mittelpunkt ihres Handelns. Damit überzeugen sie immer mehr Kunden und während sie von den etablierten Mitbewerbern ignoriert werden, erobern sie schließlich den Markt. Als zweiten möglichen Prozess beschreibt Clayton die Schaffung neuer Märkte durch innovative Produkte oder Dienstleistungen.
Wann ist Digital auch disruptiv?
Die heute fortschreitenden digitalen Technologien haben dem neuen Verständnis der Disruption den Weg geebnet und Möglichkeiten erschaffen, wie sie in der analogen Welt kaum denkbar waren. Dabei waren die Nerds in den IT-Abteilungen schon immer auch disruptiv unterwegs. Für sie gehört das neue, das andere quasi zur DNA. Die Nerds pflegen ihre eigene Kultur, kümmern sich nicht um die Konventionen und Regeln des Geschäftslebens und werden deshalb schon argwöhnisch betrachtet. Gepaart mit geschäftlichem Erfolg werden sie gar als Bedrohung wahrgenommen. Vor allem wenn sie in konservative Geschäftsfelder wie beispielsweise die Finanzwelt vordringen und Geschäftsideen und Technologien entwickeln, die geeignet sind, die Bankenwelt auf den Kopf zu stellen, von etablierten Bankern aber kaum verstanden werden. Fintechs! Was soll das sein? Das klappt nie! So verwundert es nicht, wenn inzwischen jede scheinbare digitale Innovation auch als digitale Disruption bezeichnet wird. Nicht selten ein Fehlurteil.
So werden beispielsweise der Fahrdienst Uber oder die Vermietungsplattform AirBNB als Leuchttürme disruptiver Digitalisierung betrachtet. Wendet man allerdings Claytons Definition einer disruptiven Innovation an, so muss man in beiden Fällen zu einem anderen Urteil kommen. Beide Unternehmen setzten konsequent auf Digitalisierung und versuchen etablierte Märkte zu verändern. Sicher, Uber hat im etablierten Taxi-Gewerbe für viel Unruhe gesorgt und in etlichen Ländern neue gesetzliche Regelungen angestoßen. Doch setzt Uber nur auf ein bestehendes Geschäftsmodell auf, erschließt weder neue Märkte noch neue Kundengruppen. Uber wäre für Clayton eine erhaltende Innovation. Dennoch hat das amerikanische Start-up die Welt der Taxiunternehmen durcheinander und gegen sich aufgebracht. In den meist kleinen Taxiunternehmen herrschte anfangs regelrechte Panik angesichts des milliardenschweren Start-ups aus dem Silicon Valley.
Flussaufwärts gegen den Strom
Jahre zuvor hatte der etablierte Buch- und Einzelhandel in Deutschland eine ähnliche Erfahrung gemacht. Mit dem zunehmenden Erfolg von amazon forderten die örtlichen Buchhändler nach Regulierung und bettelten ihre Kundschaft regelrecht an, ihre Bücher doch weiterhin am Ort zu kaufen. Sonst, so die weitverbreitete Drohung, würde es bald keinen lokalen Buchhandel mehr geben. Die Gegenwart zeigt ein anderes Bild. Der Buchhandel hat sich verändert, aber er lebt noch immer.
Unternehmen sollten daraus eine wichtige Lehre ziehen, sie müssen die neuen Herausforderungen als Chance begreifen. Unternehmen die im Red Ocean – dem gesättigten Markt bequem mitschwimmen wollen, werden auf Dauer untergehen. Wettbewerb und Unsicherheit sind eine Tatsache, die als Chance begriffen werden muss. Unternehmen mit disruptivem Potenzial erkennen die Chancen, verlassen etablierte Strukturen und stoßen in neue Märkte – dem Blue Ocean vor. Digitalisierung bietet die Möglichkeit und disruptive Digitalisierung ist die Chance.
Der Köder muss dem Fisch schmecken und nicht dem Angler, ist eine bekannte Weisheit aus Marketing und Werbung. Sie beschreibt ebenso deutlich die Herausforderung und den Anspruch digitaler Disruption. Produkte und Dienstleistungen müssen besser und wettbewerbsfähiger werden und nicht einfach nur cooler. Digital disruptive Produkte sind intuitiv, sie wecken Bedürfnisse, die der Kunde vorher nicht hatte und sie verändern Lebensgewohnheiten. Keine 15 Jahre ist es her, das hat der US-Amerikaner Steve Jobs mit seinem Unternehmen Apple ein Produkt auf den Markt gebracht, dessen Nutzen viele zunächst nicht erkannten. Als 2007 das erste I-Phone in den Regalen lag, war nicht zu ahnen, welche Bedeutung es innerhalb kürzester Zeit erlangen konnte. Heute ist ein Leben ohne Smartphone kaum mehr vorstellbar. Der Erfolg lag sicher in der Weitsicht eines Steve Jobs, aber er hat noch weitere Väter. Denn mit dem Siegeszug der Smartphones hat sich der Umgang mit digitalen Inhalten jeder Art vollständig verändert.
Jobs hat mit dem I-Phone einen Kundenutzen geschaffen, den es vorher nicht gab und der jetzt nicht mehr wegzudenken ist. Er hat die Stärke Appels genutzt, intuitiv bedienbare und dabei noch schön anzusehende Produkte zu entwickeln und gleichzeitig ein plattformbasiertes Geschäftsmodell etabliert. Erst das vielfältige Angebot an Apps machte aus dem I-Phone das erfolgreiche Produkt. Erst die App macht aus dem I-Phone das Produkt mit echtem Kundennutzen und sorgt für den entscheidenden Impuls: Das muss ich haben. Apple hat sich dabei voll auf seine Kernkompetenz konzentriert und die Fähigkeit zur Entwicklung leistungsfähiger Apps, genau denen überlassen, die davon etwas verstehen. Durch die Bündelung auf dem eigenen Marktplatz ist Apple aber immer noch Herr über das Geschehen und Gatekepper für das Hauptprodukt I-Phone.
Digitale Disruption ist kein Schicksal, sondern eine Haltung
Apple hat im besten Sinne disruptiv gehandelt. Hat einen neuen Markt und ein neues Kundenbedürfnis aus der Taufe gehoben, hat Handys vorheriger Bauart fast vollständig vom Markt verdrängt und damit schlussendlich den Gesamtmarkt der Informations- und Kommunikationstechnologie nachhaltig verändert. Denn aus dem zaghaften „online first“ der 2000er Jahre ist längst ein „mobile first“ geworden. Wie konnte das gelingen? Apple und Steve Jobs in Person machten zu dieser Zeit und auch die Jahre davor zwei Dinge sehr richtig.
Jobs hat quasi eine Unternehmenskultur der digitalen Disruption gepflegt. Alles sollte möglich sein oder möglich gemacht werden. Apple hat die digitale Transformation bereits gelebt, als sie in vielen etablierten Unternehmen noch skeptisch betrachtet wurde. Nach den schweren Rückschlägen durch die Dotcom-Blase war in vielen Unternehmen business as usual angesagt, hatten Werte, Produkte und Prozesse etablierter Industrien wieder Konjunktur. Unternehmen wie Nokia hat diese Entwicklung, neben anderen Managementfehlern, sprichwörtlich das Genick gebrochen. Heute spielt der einstige Star der Mobilfunktechnologie praktisch keine Rolle mehr.
Allerdings war der Siegeszug des I-Phones nicht vorhersehbar. Unternehmen die die digitale Transformation aktiv mitgestalten wollen brauchen eine hohe Risikotoleranz. Scheitern nicht ausgeschlossen. Sicher wollte Jobs nicht zu den Verlierern gehören, aber er ist das Risiko eingegangen. Nicht kopflos, sondern mit einer Unternehmenskultur die Kreativität, Schnelligkeit, Präzision und Kundennutzen zum Dogma erhob und einer Unternehmensstrategie der digitalen Disruption. Für Jobs war klar, die Karten werden jetzt neu gemischt. Wer dann abwartet und nur auf bewährte Konzepte setzt wird nicht zu den Gewinnern gehören. Komfortzone gegen Siegertreppchen ist die Entscheidung die Unternehmen aktiv treffen müssen.
Diese Entscheidung haben auch andere Unternehmen aus dem Silicon Valley und der weltweiten Start-up-Szene getroffen. Sie wollen zu den Siegern gehören und setzen oftmals alles auf eine Karte, im festen Glauben an die Überlegenheit ihres Geschäftsmodells. Doch längst nicht jedes, mit Milliarden gepimpte Jungunternehmen ist ein Vorreiter digitaler Disruption. Nicht selten werden einfach nur Modeerscheinungen verfolgt, wird kopiert und möglichst schneller skaliert als es die Konkurrenz schafft. Mit viel Geld wird die Strategie des First-Mover-Advantage verfolgt in der Hoffnung den Markt zu beherrschen. Dabei können Kreativität, Innovationsgeist und Kundenutzen auf der Strecke bleiben.
Unternehmen die wirklich digital disruptiv unterwegs sind, folgen keinen Modeerscheinungen, sondern erkennen langfristige Trends, surfen auf dieser Welle zum Erfolg und gestalten ihre Märkte. Das erfordert manchmal einen langen Atem und der muss durch mutige Investoren ermöglicht werden. Ein Beispiel dafür ist Facebook. Die Idee und Vision von Marc Zuckerberg wurden von vielen Akteuren lange nicht verstanden. Heute sind soziale Netzwerke nicht mehr aus unserem Alltag wegzudenken.
Echte digitale Disruption ist also nicht einfach nur ein digitales Kleidchen für bestehende Produkte. Für digital affine Führungskräfte sind digitale Transformation und disruptive Innovation Antrieb und digitale Disruption nicht nur ein Buzzword, sondern unternehmerische Chance.
Diesen Magazin-Text habe ich als Ghostwriter für einen Managementberater geschrieben.